Foodporn – Was Essensfotos im Social Web bedeuten
Die Sozialen Netzwerke quellen über vor lauter Fotos von Essen. Was soll das und wieso inszenieren die Menschen das, was auf ihren Teller kommt?
Jeden Tag landen abertausende Essensfotos im Social Web. Der Hashtag #Foodporn liefert bei Instagram über 35 Mio., der Hashtag #Food sogar mehr als 128 Mio. Bilder. Was ist es, das so viele Menschen dazu bringt, ihr Essen zu fotografieren und ihren Kontakten zu präsentieren? Ist es eine Disziplin im Wettbewerb um Aufmerksamkeit, Anerkennung und Status, vergleichbar mit den immer gleichen Fotos von rucksackreisenden Wohlstandskindern an exotischen Destinationen? Ist das Ziel Überlegenheit? Isst man mit den Augen, seit der physiologische Zustand Hunger immer seltener geworden ist? Worum geht es bei #Foodporn?
Eines ist klar: Essen ist nicht gleich Essen. Ein Instagram-Foto vom Süßkartoffel-Minze-Tabuleh mit Seitan und Cashew-Topping lässt Individualismus, interkulturelle Kompetenz, bewussten Lebenswandel und den ethisch motivierten Verzicht auf Fleisch erahnen. Das Foto-Tweet vom saftigen Hamburger verweist auf das Bekenntnis zum Genuss, auf laissez faire, Hedonismus, Lebensfreude, Pop. Und in Kombination mit dem Hinweis auf ein angesagtes Have-to-go-Lokal oder die heimische Küche lässt sich am Foodpic sogar noch ein bisschen mehr über den sozialen Status des Urhebers ablesen. Und klar: Auch kulinarische Geschlechter-Klischees gibt es.
Essen als soziales Distinktionsmerkmal
Dass sich gesellschaftliche Milieus auch durch ihre Ernährung voneinander abgrenzen, ist weder neu noch ein Geheimnis. Durch das Erodieren klassischer sozialer Milieus ist es allerdings mehr denn je der Lifestyle, der Identität stiftet und das Social-Self-Marketing in den Sozialen Netzwerken eignet sich zum Gestalten der eigenen Identität blendend. Dass dabei ausgerechnet das Essen eine wichtige Rolle spielt, ist für die Online-Strategin Judith Denkmayr plausibel. Für die Wiener Social-Media-Beraterin sind Fotos von Mahlzeiten niedrigschwellige Massenware: »Welchen Content hat jeder von uns, ohne sich besonders kreativ oder technisch aufwendig betätigen zu müssen? Baby- und Familienfotos, Fotos unserer Haustiere, Urlaubsfotos – und eben auch Essensfotos.«
Auf der anderen Seite liefert professionelle Food-Fotografie die Blaupause für die Fotoflut des Social Web. Der Fotograf Cliff Kapatais fotografiert seit Jahren Essen und beobachtet in den letzten Jahren einen Boom. »Die Entwicklung ging vom Bodenständigen zum Adventure – es geht nicht mehr nur darum, satt zu werden, Essen muss ein Erlebnis sein und auch so aussehen. Das Auge isst mehr denn je mit!« Dabei gibt es Moden, weiß der Profi-Foodpornograf: »Früher war alles eher opulent angerichtet. Heute kommen reduzierte Schlichtheit und Minimalismus auf den Teller.«
Das Thema Essen ist natürlich auch an den Sozialwissenschaften nicht vorbeigegangen. Der Kulturanthropologe Claude Lévi-Strauss stellte Anfang der 60er-Jahre fest, in der »Sprache der Küche« seien alle gesellschaftlichen Strukturen repräsentiert, und stellte sie daher gleichwertig neben die »Sprache der Worte«. Dieser schöngeistige Kunstgriff ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Judith Denkmayr sieht es nüchterner: »Wir reagieren auf Essensfotos sehr stark – kein Wunder. Essen und Trinken sind in der Maslow’schen Bedürfnispyramide Teil der untersten Stufe. Essen ist ein Grundbedürfnis, kein gesunder Mensch kann ohne Essen auskommen.« Dass Essen darüber hinaus als soziales Ausdrucksmittel und Unterscheidungs-Merkmal dient, liegt auf der Hand. Es ist kein Wunder, dass Pierre Bourdieu seine Studie über »Die feinen Unterschiede« mit dem Thema Essen einleitet.
Am Anfang des sozialen Habitus steht das Essen, könnte man zusammenfassen. Nicht allen ist die soziale Bedeutung, mit der wir unser Essen versehen, geheuer. Der Guardian-Kolumnist Steven Poole zum Beispiel fühlte sich schon vor einer Weile von Hipstern, die ihm ihr Essen unter die Nase rieben, genervt und hat unter dem Titel »You Aren’t What You Eat: Fed Up With Gastroculture« 2012 ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass Foodisten ihre Nahrungsmittel zu ernst nehmen. Er unterstellt dem verbreiteten Food-Fetisch etwas Asoziales: Schließlich seien die Foodisten auf ein durch Billigfleisch und Fertigprodukte gesättigtes Nahrungsprekariat angewiesen, um sich an ihrer kulinarischen Überlegenheit zu erfreuen.
Zeig mir, was du isst, und ich glaub zu wissen, wer du bist
Wer am Anfang des Monats sein Budget auf den Bauernmarkt trägt, landet am Monatsende vielleicht doch noch beim Discounter. Nach außen getragen wird freilich lieber die Szene vom Bauernmarkt. Kocht man für Gäste, dann überlegt man sich vorher, was man kocht. Wirft man mit exotischen Zutaten um sich, bei denen man eventuell noch eine Anekdote über die indigene Bevölkerung des Anbaugebiets mitliefern kann? Oder soll es doch lieber das heimliche Leibgericht aus Mutters Küche geben, das man schon seit Jahrzehnten kennt und das auf dem Teller eher hässlich aussieht, aber an dem so viele Erinnerungen hängen, dass man es nur mit ganz bestimmten Leuten teilen mag? Was man gerne isst, das gehört zur eigenen Identität. Jeder hat seine kulinarischen Favoriten, Guilty Pleasures und No-Gos. Was davon man öffentlich macht, das gehört zur Inszenierung der eigenen Person. Weinliebhaber trinken gerne guten Wein. Leute, die als Weinliebhaber wahrgenommen werden wollen, reden gerne über guten Wein.
Foodporn ist da viel einfacher. Man braucht keine Fachterminologie zu kennen und nicht einmal kochen können, um sich als Gourmet in Szene zu setzen. Im Handumdrehen bringt man sich in Verbindung mit der uralten und hochangesehenen Kulturtechnik des Zubereitens exquisiter Speisen. Je nach Situation lässt sich die kulinarische Inszenierung variieren. Hausmannskost oder Haute Cuisine, Fast oder Slow Food, Hedonismus oder Askese, Gastronomie oder selbst gekocht, exotisch oder heimatverbunden. Welche Spielarten von Foodporn das Netz dominieren, das dokumentiert die Seite foodpornindex.com. Sie wertet die mit dem Hashtag #Foodporn geposteten Darstellungen von Essen aus und zeigt, wie viel davon gesund, ungesund, fettig, leicht, Gemüse, Fleisch ist. Soviel sei gesagt: Fettige Speisen dominieren das Netz.
Wie inszenieren wir uns als nächstes?
Es ließe sich nun die Frage stellen, ob das alles alarmierend oder beruhigend ist. Mit ein wenig gutem Willen ist anzunehmen, dass die meisten Urheber von Foodporn nicht die alltäglichen Speisen ins Netz stellen, sondern die seltenen Eskapaden. Die interessante Frage ist: Über welchen Lebensbereich inszenieren wir uns online als nächstes? Mode, Haustiere, Sport, Reisen – alles schon da. Autos und Immobilien sind elitär, also bestens geeignet – und doch antiquiert. Mit Bildung lässt sich gut kokettieren. Selfies vor Bücherregalen, #Shelfie genannt, hat es als kurzen Trend schon gegeben. Müssen wir uns auf #Flatporn oder #Gardenporn einstellen? Geht der Trend ins grüne, zu #Natureporn oder #Outdoorporn? Vielleicht werden handwerkliche Fertigkeiten bedeutender, sodass #DIYporn das next big thing wird. Und was steht eigentlich am Ende der Selbstinszenierungen? Bleibt irgendwann nur mehr #Porn?
What the f*** is Foodporn?
Im engeren Sinne hat Foodporn wenig mit Pornografie zu tun, ist asexuell und höchstens auf sehr individuelle und spezielle Art und Weise erotisch. Foodporn basiert auf dem Fotografieren von Essen, also auf dem Anfertigen von Nahrungsaufnahmen, in aller Regel vor dem Verzehr. Hochglanz-Magazine und das Internet sind voll von Essensfotos. Werden diese Bilder ins Social Web gestellt, ob bei Facebook, Twitter oder Instagram, versehen die User sie meist mit dem Hashtag #Foodporn. Es ist zum geflügelten Wort geworden. Hashtags ordnen die unterschiedlichsten Arten von Postings nach Begriffen, sie sortieren das Netz. Im geruchs- und geschmacklosen Web 2.0 ist dabei irgendwie die Essens-Abteilung zu einer der größten in den sozialen Netzwerken geworden.
Unser Autor Thomas Stollenwerk postet auf Twitter vielleicht auch Fotos von seinem Essen: @thmsstllnwrk







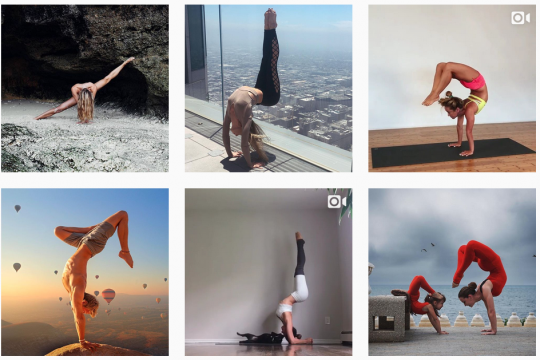

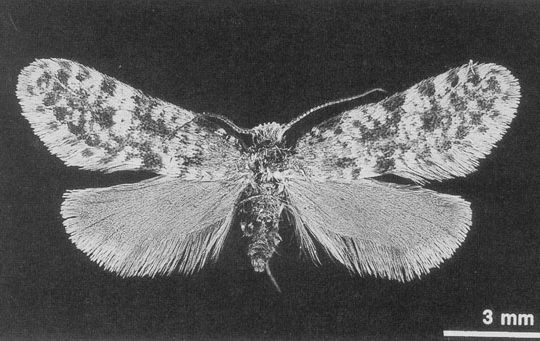


 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.