Die vielen kleinen Bausteine nachhaltiger Lebensstile

Mit nachhaltigen Lebensstilen lässt sich einiges erreichen. Und noch mehr, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Fünf Footprints im Porträt.
Immer mehr Menschen behaupten von sich, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. Wer schon einmal seinen CO2-Footprint ermittelt hat, weiß, dass es nicht besonders schwer fällt, den eigenen Wert deutlich unter den österreichischen Durchschnitt zu senken. Dennoch: In der Gesamtbewertung stehen dann Sätze wie »Trotzdem würde es noch 1,3 Planeten von der Qualität der Erde erfordern, um allen ErdenbürgerInnen den gleichen Zugriff auf Ressourcen und Energie zu ermöglichen.« Jeder individuelle Beitrag ist richtig und wichtig. Immerhin liegt der direkt zurechenbare Beitrag von Privatpersonen bzw. privaten Haushalten zu den CO2-Emissionen bei etwa einem Drittel. Der persönliche Gestaltungspielraum ist allerdings nicht besonders groß. Gemeinsam mit dem Institut für Soziale Ökologie der Alpen Adria Universität hat BIORAMA einige Beispiele für nachhaltige Lebensstile analysiert und über die Rahmenbedingungen gesprochen, die es für eine nachhaltige Gesamtentwicklung braucht.
»Das Ideal« – ein Abschied
Kurt Tucholsky hat 1927 ein Ideal formuliert: »Ja, das möchste: Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße.« Dieser Wunsch nach einem Leben am Land mit einer voll ausgebauten Infrastruktur ist 2012 immer noch da. Seine Erfüllung ist heute zwar technisch realisierbar, stößt allerdings an neue Grenzen. Die Menschen in den Industrienationen leben eindeutig auf zu großem Fuß und selbst wenn die USA oder die Arabischen Emirate durchschnittlich die doppelte Menge an globalen Hektar (gha) pro Person beanspruchen: 4,9 gha pro Person in Österreich sind noch immer zu viel. Ein »Global Hektar« entspricht einem Hektar weltweit durchschnittlicher biologischer Produktivität. Würden alle Menschen auf der Erde so leben wie die Österreicher, bräuchte es drei Planeten dieser Art.
Die flächendeckende Erfüllung des Wunsches nach einem Haus im Grünen ist schlichtweg nicht vertretbar. Willi Haas, der seit vielen Jahren am Institut für Soziale Ökologie zu dem Thema forscht, führt die Effizienzvorteile einer urbanen Lebensweise aus: Die täglichen Wege sind kurz, in dicht verbauten Gebieten können Heizung, Wärmeisolierung, Ver- und Entsorgung deutlich ressourcenschonender gestaltet werden und auch Aufbau und Wartung der Infrastruktur sind pro Kopf günstiger. Smart Cities ist das Zauberwort: städtische Strukturen, die Lebensqualität und Ökologie in Einklang bringen. Die autofreie Siedlung im Wiener Stadtteil Floridsdorf, in der die Pensionistin Yutica Calal lebt, ist im weiteren Sinne so eine Smart City. Willi Haas hat die Siedlung mit einer Referenzsiedlung in nächster Nachbarschaft verglichen. Die wichtigsten Ergebnisse: Die autofreie Siedlung weist geringere CO2-Emissionen pro Person und per Haushalt auf und das Umweltbewusstsein ist in dieser Siedlung generell höher. Das zeigt Frau Calal mit einem Wert von 2,3 Hektar auf besonders konsequente Weise. Sie betont, dass sie die selbst auferlege „Sparsamkeit“, wie sie es nennt, in „keinster Weise an einem sehr vergnüglichen und erfüllten Leben hindern“.
Die Definition von Lebensqualität
Wirtschaftliches Wachstum ist noch immer der Imperativ der gesellschaftlichen Entwicklung und die mitteleuropäischen Lebensstile basieren weitgehend auf Konsum und (Über-)Produktion. Umweltpolitik hat sich bislang primär auf die ökologischen Aspekte von Konsum und Produktionsprozessen konzentriert und sich weniger mit der Frage beschäftigt, warum Menschen Produkte wählen und wie sie sie verwenden. Auf EU-Ebene gibt es mittlerweile einige Forschungsprojekte, die hier ansetzen. »SPREAD Sustainable Lifestyles 2050« versucht eine gesamthafte Sichtweise auf Konsum, Wohnen, Mobilität sowie Gesundheit und Gesellschaft zu etablieren. Dazu gehören auch Policy-Vorschläge, die ein Umfeld für nachhaltige Lebensstile schaffen und Maßnahmen, die beim Verständnis von Lebensqualität ansetzen. Mehrere Studien belegen, dass ab Erreichen eines gewissen Wertes kein Zusammenhang mehr zwischen Einkommen und subjektiver Zufriedenheit besteht. Andere Faktoren wie etwa Gesundheit, Freizeit und Sozialkontakte gewinnen an Bedeutung. Die gezielte Förderung dieser Aspekte soll langfristig den Wachstums-Imperativ eindämmen. Soziale Kohäsion hängt eng mit Verteilungsgerechtigkeit zusammen. Und diese wiederum hat auch eine ökologische Dimension: Eine Studie, die in Tschechien, Spanien und Großbritannien durchgeführt wurde, zeigt, dass die pro Kopf verursachten Umweltbelastungen in höheren Einkommensgruppen mindestens doppelt so hoch sind wie in den niedrigsten Einkommensgruppen.
Bewusstseinsbildung
Das Leben am Land ist aus individueller Sicht erstrebenswert. Auch wenn es aus übergeordneter Perspektive problematisch ist, führt es doch die Auswirkungen des eigenen Tuns vor Augen. Jochen Schützenauer hat sich mit seiner Frau den Wunsch nach einem Häuschen am Rand des Wienerwalds erfüllt. Er fährt jeden Tag knapp 30 Kilometer ins Büro nach Wien, ist aber dennoch der Meinung, nachhaltiger zu leben als viele Stadtmenschen. Müll wird hier nur selten abtransportiert, die Verantwortung für die Senkgrube liegt bei ihm und jedes Holzscheit, mit dem die Schützenauers ihren Holzofen beheizen, tragen sie selbst ins Haus. „Wenn man sich selbst um Dinge kümmern muss, die einem in der Stadt abgenommen werden, lernt man wieder, dass man es auch anders machen kann“, meint er. Willi Haas kann das auf sehr abstrakter Ebene bestätigen. In Materialanalysen hat er festgestellt, dass die Produktion in wenig vernetzten Gebieten deutlich nachhaltiger ist als in modernen Strukturen. So unmittelbar wie von 200 Jahren spürt man die Auswirkungen seines Tuns aber auch am Land nicht mehr. So sind die etwa 600 Kilogramm Emissionen verursacht durch 7.000 Kilometer Autofahrten im Jahr aus den Augen aus dem Sinn.

Gemeinsame Nutzung von Ressourcen
Die meisten Berechnungsmodelle für individuelle CO2-Footprints beziehen sich auf den jeweils aktuellen Status. Der Materialaufwand für die Errichtung von Wohnungen müsste individuell berechnet werden. Immerhin macht der Bau-Sektor in Österreich etwa 50 Prozent der Materialflüsse aus. Die Bandbreite ist groß: Lena Siebert etwa lebt mit ihrem Kind und ihrem Mann in einer Wohnwagensiedlung in der Lobau. Dafür wurden zwei alte Wohnwägen ausgebaut. Die High-Tech Variante davon nennt sich Mikrohaus und ist ein nach modernsten Gesichtspunkten ausgestatteter Wohncontainer, den das Ehepaar Smolak bewohnt. Und schließlich gibt es da noch das Haus von Elisabeth Bauer, erbaut um 1800, bei dem der Kern, eine alte Bauernstube, erhalten blieb und der Rest neu gebaut wurde. Geheizt wird mit Erdwärme. Die Wärmepumpe wird mit Ökostrom betrieben.
Dass Lena Sieberts CO2-Footprint nur 2,7 gha beträgt, liegt zu einem Gutteil auch daran, dass in der Wohnwagensiedlung vieles wie Kühlschrank, Waschmaschine, Sanitäranlagen und Sieberts Auto gemeinsam genutzt werden. Auch das wird im SPREAD-Projekt ausführlich diskutiert: Eine gemeinsame Nutzung hochwertiger Geräte mit langer Lebensdauer ist allemal besser, als wenn jede Person oder jeder Haushalt eine billige Vollausstattung wählt, die bald wieder auf dem Müll landet.
Von der Output- zur Inputseite
Willi Haas arbeitet sehr viel mit der Analyse von gesellschaftlichen Input-/Outputflüssen. Bislang hat man sich in der Umweltpolitik hauptsächlich mit der Output-Seite beschäftigt. Und auf der liegen auch die Schrauben, an denen Privatpersonen drehen können. Er ist skeptisch, ob die Ergebnisse aus Projekten wie SPREAD so bald in der Realpolitik ankommen. Derzeit ist es noch so, dass die Politikdomänen Wirtschaft und Umwelt getrennt sind. Die Wirtschaftspolitiker kümmern sich um die Inputs, während die Hebel, mit denen Umweltpolitiker an der Output-Seite ansetzen können, relativ klein sind. Größere Änderungen erwartet Haas erst, wenn sich auch etwas an der gesamtökonomischen Situation ändert: etwa eine drastische Verteuerung fossiler Brennstoffe (die für ihn ziemlich sicher kommt) oder eine stärkere Konzentration der stark wachsenden Ökonomien China und Indien auf ihren eigenen Binnenmarkt. Europas Wirtschaft ist stark von Rohstoffimporten abhängig. Wenn deren Preise steigen, steigen damit auch die Weltmarktpreise von Gütern aus europäischer Produktion empfindlich. Solche Argumente ziehen auch bei Menschen, die ansonsten in Umweltfragen wenig sensibel sind. »Dann wird es gut sein, Forschungsergebnisse wie die aus dem SPREAD-Projekt in der Tasche zu haben«, meint er.
Schlüsselfrage Mobilität
Privatpersonen können mit nachhaltigen Lebensstilen einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. In den Bereichen Konsum, Ernährung und Wohnen liegen die möglichen Maßnahmen auf der Hand. Viele lassen bereits heute individuell umsetzen. Teilweise müssen aber auch die Rahmenbedingungen drastisch geändert werden. Haas führt als Beispiel die Barrieren bei Nutzer- und Eigentümer Verhältnissen an: Bei Mietwohnungen begleichen die Mieter die Heizkosten, während die Eigentümer für die Wärmedämmung zuständig sind. Für die Politik gibt es viel zu tun. Vor allem im Bereich Mobilität, die seit Jahren das stärkste Wachstum am CO2-Inventory aufweist, werden die falschen politischen Signale gesetzt. Der motorisierte Individualverkehr und Transporte per LKW haben nach wie vor Vorrang und Flugreisen, die den persönlichen Footprint dramatisch vergrößern, werden aufgrund der niedrigen Preise immer beliebter. Hier müssen die individuellen Beiträge und die Rahmenbedingungen ganz besonders zusammenspielen.
Die befragten Personen stehen für einen Durchschnittswert von knapp über 3 gha. Wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden, würden wir noch immer einen weiteren (etwas kleineren) Planeten benötigen.
Als Grundlage für die Ermittlung der CO2-Footprints diente der CO2-Rechner des Österreichischen Lebensministeriums. Das Konzept dafür wurde am Institut für Soziale Ökologie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt entwickelt.
- Margarethe Smolak ist mit ihrem Mann von einer Neubauwohnung in ein Mikrohaus gezogen. In der Wohnung hat sie die Nachbarn durch die Wände gehört und sich mit Schimmel herumgeplagt. Der Wohncontainer mit 48 Quadratmeter Wohnfläche ist eine perfekt ausgestattete Wohneinheit, mit der sie nach ihrer Pensionierung ins Burgenland übersiedeln will. »Die Österreicher haben zu wenig Mut, Neues auszuprobieren.« Die Smolaks machen mindestens eine Fernreise im Jahr. Trotzdem ist ihr CO2-Footprint vergleichsweise klein. CO2-Footprint: 3,3 (sehr klein)
- Sie wollte den Kern des um 1800 gebauten typischen Mühlviertler Hauses behalten. So hat Elisabeth Bauer nur einen Teil abgerissen und ein modernes Haus um die alte Bauernstube gebaut, das sie mit Erdwärme beheizt. Viele der Einrichtungsgegenstände sind mühevoll restaurierte Stücke aus dem alten Bestand. Frau Bauer arbeitet im Pflegedienst und hat keine andere Möglichkeit, als mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu fahren. Bald wechselt sie aber ihre Arbeitsstätte und kann ihren Arbeitsplatz zu Fuß erreichen. Das wird ihren CO2-Footprint nochmals verkleinern. CO2-Footprint: 3,5 (klein)
- Die Physikerin Jana Siebert ist derzeit in Karenz. Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Mann lebt sie in einer Wohnwagensiedlung in der Lobau. »Ich bin da einfach reingewachsen. Mein Freund hat schon hier gelebt und ich habe festgestellt, dass das auch für mich passt.« Recycling alter Geräte und Möbel und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen prägen das Leben in der Siedlung. CO2-Footprint: 2,7 (sehr klein)
- Yutica Canal lebt in einer autofreien Siedlung in Wien Floridsdorf. »Es ist wie in einem modernen Dorf«, meint sie, »man kennt sich einfach. Für ein Leben in der Stadt ist so etwas einfach ideal«. Sie verzichtet auf Fleisch und Milchprodukte und fährt ausschließlich mit der Bahn auf Urlaub. »Wenn alle wie ich wären, würde die Wirtschaft zugrunde gehen!« CO2-Footprint; 2,3 (sehr klein)
- Jochen Schützenauer hat mit seiner Frau vor zwei Jahren ein kleines Haus am Rand des Wienerwaldes gekauft, das er mit Holz beheizt. Er fährt jeden Tag mit dem Auto knapp 30 Kilometer nach Wien zur Arbeit. »Ich lebe dennoch nachhaltiger als die meisten Menschen, weil ich am Land gezwungen bin, Dinge bewusster zu tun.« CO2-Footprint: 3,5 (klein)








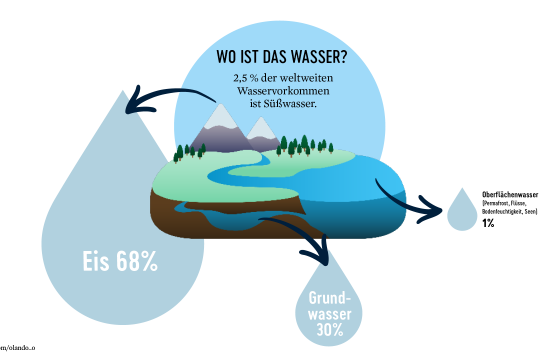





 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.