Zurück zum Ursprung
Der Fleischer hat die letzten drei Kühe geholt. Die Milchwirtschaft rechnet sich nicht mehr für Maria und Peter Prinz. Die Sache, für die ihr Sohn in der Stadt kämpft – Veganismus! Tierrechte! –, scheint einen Schritt weiter. Familienaufstellung im leeren Stall.

Milch aus dem Tetrapak, das ist hier etwas Neues. Anfangs schämte sich Maria Prinz sogar dafür, keine selbst gemolkene Milch mehr zu haben. »Mittlerweile geht’s«, sagt die 51-Jährige, als sie die Kuhmilch für den Kaffee auf den Küchentisch stellt. »Ich hab am Anfang nur eingekauft, wo mich niemand kennt.« Dabei hatte sich ohnehin schnell herumgesprochen, dass es am Hof der Familie Prinz, die hier 1848 erstmals urkundlich erwähnt wird, keine Rinder mehr gibt, als zu Jahresende die letzten drei Kühe abgeholt wurden. In Oberlainsitz, wo jede jeden von klein auf kennt, waren Maria und ihr Mann Peter (ebenfalls 51) die Letzten, die noch Milchkühe gehalten hatten. Die Wiesen und Felder hier im nördlichen Waldviertel, wenige Kilometer vor der Grenze nach Tschechien, sind allesamt nicht in Gunstlage. Das Klima ist rau, der Boden karg, die Gegend mit ihren Hügeln zwar beschaulich. Gemäß den Förderkriterien gelten Maria und Peter Prinz aber bereits als Bergbauern. Was mit ihrem Hof weiter passieren soll, wissen die beiden nicht. Spätestens seit der Fuchs auch noch die freilaufenden Hühner geholt hat, fehlt hier etwas. Ein Zufall, dass der Fuchs gleich alle Hendln holte, klar; aber einer, dessen Symbolkraft sich schwer leugnen lässt. Denn womöglich markiert ihr leerer Stall, ein Bauernhof ganz ohne Tiere, das Ende einer Epoche – symbolhaft weit über die paar Hektar Wiese, Wald und Ackerland hinaus, die man selbst bewirtschaftet. Dieses Gefühl liegt hier zumindest in der Luft. Auch später, als Maria eine dampfende Schüssel veganes Erdäpfelgulasch bringt.
Der Stall ist leer, »die Leute reden«
Inzwischen hat Peter Prinz mit einem Ordner Platz genommen und blättert in seinen Aufzeichnungen.»Arielle war sieben«, murmelt er, »Biene vier und Birke drei Jahre alt«. Jede der Kühe hat ein Stammblatt. Ohrmarkennummer, Milchqualität, Anzahl der Kälber, Milchleistung; alles ist hier vermerkt. »Die haben alle auch wirklich auf ihre Namen gehört«, erinnert sich Maria. Sie hat die Tiere gemolken. Bis zuletzt – 27 Jahre lang, zwei Mal am Tag –, und bis es irgendwann gar nicht mehr ging. Weder wirtschaftlich noch gesundheitlich. »Vom Milchgeld übrig geblieben ist ohnehin nichts«, sagt sie. Nebenbei hat sie als Kellnerin gearbeitet, drei Kinder großgezogen. Heute kann sie kaum noch gehen. Zwischen Küche und Küchentisch rollt sie geschickt auf einem Bürosessel hin und her. »Samstag, Sonntag, Weihnachten durch«, sagt ihr Mann, »ich hab zuerst noch geglaubt, ich kann allein weiterwurschteln, aber das geht nicht.« Das Geld reiche kaum für einen, arbeiten müssten aber zwei. Es ging einfach nicht mehr. Aber als die letzten drei Kühe abgeholt waren – »es war der Horror«, sagt Peter Prinz, »nicht nur im leeren Stall. Die Leute reden«.
Die Geschichte von Peter und Maria Prinz wäre nicht weiter außergewöhnlich. Jedes Jahr hören viele Milchviehbetriebe auf. Hunderte, Tausende; in Österreich, in Deutschland, weltweit. Ein weiterer leerer Stall, während die verbleibenden Betriebe größer werden, mehr Kühe halten, die mehr Milch geben. Zwar gilt die Milchbranche immer noch als Wachstumsbranche. Doch der Wettbewerb ist hart. In Deutschland hat seit 2015 beinahe ein Viertel aller Milchhöfe aufgegeben. In Österreich sank die Zahl der Milchkühe zuletzt um 3010 Tiere auf 524.000 (Deutschland 2020: 3,9 Millionen Milchkühe). Vor allem kleine Höfe wie der Hof von Maria und Peter Prinz lassen die Milchviehhaltung bleiben. Weil die durchschnittliche Milchleistung pro Kuh durch Kraftfuttereinsatz immer noch zunimmt, wird unterm Strich mehr Kuhmilch produziert. Die deutsche Milchkuh liefert derzeit durchschnittlich 8457 Kilogramm Milch pro Jahr. In Österreich sind es durchschnittlich 7300 Kilogramm. Am Hof der Familie Prinz waren es 6000 Kilogramm (»Wir haben keinen zugekauften Mais und kein Soja gefüttert, nur unser eigenes Getreide«, sagt Peter Prinz).

In Oberlainsitz wird allerdings nicht nur über den leeren Stall von Maria und Peter geredet, sondern auch über ihren Sohn Georg (27). Georg hat seit bald zehn Jahren keinen Schluck Milch mehr getrunken. Seinetwegen hat Mutter Maria an diesem Tag ein veganes Gulasch aufgetischt. Nach Hause kommt er nur mehr alle heiligen Zeiten, wie man hier sagt; zu Ostern, zu Weihnachten, zu besonderen Anlässen. Doch den Georg kennen sie im Ort mittlerweile vor allem aus den Medien. Er ist eine der lautesten Stimmen der österreichischen Tierrechtsbewegung. Offiziell ist Georg Prinz einer der Sprecher des Vereins gegen Tierfabriken, kurz: VGT. Praktisch wirkt Prinz weit darüber hinaus. Er arbeitet gemeinsam mit Martin Balluch, dem Philosophen und Tierethiker, bekannt geworden als Angeklagter im spektakulären Wiener Neustädter Tierschutzprozess, später freigesprochen vom Vorwurf der Gründung einer kriminellen Vereinigung. An Balluchs Seite vernetzt sich der Endzwanziger Prinz als Vertrauensperson mit anderen NGOs. Er verhandelt mit politischen VertreterInnen, organisiert das Campaigning gegen Pelztierzucht, Massentierhaltung.
Eine Tierfabrik war der Prinzhof nie. Für mehr als 35 Rinder war nicht Platz; allerhöchstens hielt man 13 Milchkühe am Stück, dazu kamen Kälber, ein paar Kalbinnen. Dennoch habe Georg »fast alles« am Hof seiner Eltern kritisiert, sagt er. Die Kühe wurden enthornt. Die Kälber von ihren Müttern getrennt. Die Tiere waren angebunden und insgesamt zu selten draußen. »Solange man mit Tieren Geld verdient, spart man am Tier. Das ist die wirtschaftliche Logik.« Dabei war der Hof bis 2016 sogar ein Biobetrieb, einstmals einer der ersten Biobetriebe des Landes überhaupt. Zu Beginn lieferten Maria und Peter Prinz Milch für die Biotrockenmilch von Hipp. Dann war man Vertragslandwirtschaft für Zurück zum Ursprung, die Bioeigenmarke der Lebensmittelhandelskette Hofer (Teil der Gruppe Aldi Süd). Schon vor dem Auslaufen der Ausnahmeregelung für Kleinbetriebe, die eine Anbindehaltung noch eine Zeit lang akzeptiert hätte, war eine Biozertifizierung nicht mehr möglich. Der Auslauf war zu klein. Dass sein Großvater 1992 beim Stallneubau keinen modernen Laufstall gebaut hat, nennt sein Enkelsohn Georg heute »die Erbsünde des Betriebs«. Sohn Peter hatte auf der Landwirtschaftsschule bereits davon gehört, doch den eigenen Vater habe er damals nicht überzeugen können. Eine folgenschwere Fehlinvestition. Denn was früher landauf, landab üblich war – Anbindehaltung –, ist heute kaum noch argumentierbar.
Laufstall
Anders als in der traditionellen Anbindehaltung können sich Rinder in einem Laufstall relativ frei bewegen. Das ermöglicht ein artgerechteres Sozialverhalten, hat aber vielfach zur Enthornung der Tiere geführt (um Verletzungen zu vermeiden).
Wir gehen gemeinsam zum Stall. Auf den Weiden rundum liegt der letzte Schnee. Etwas verloren streifen zwei wuschelige Katzen ums Haus, Mona und Fluffy. Über dem ganzen Hof hängt ein Schleier; eine seltsame Mischung aus Wehmut, Erleichterung und Orientierungslosigkeit. Aus dem Stall tönt laut Musik. Der Vater hat vorhin in der Einfahrt gearbeitet.
Als Peter Prinz das Radio abstellt und der Schlager auf Radio Niederösterreich verstummt, hallt die Stille weiter. Ein leerer Stall hat eine scheußliche Akustik. Und die Kälte der Wände, die zuletzt nicht mehr gekalkt wurden, weil klar war, dass hier keine Tiere mehr stehen würden, kriecht nach ein paar Minuten in die Knochen. Der Betrieb ist null automatisiert. Keine Entmistungsanlage, kein Melkroboter, nichts. »Aus Sicht der frühen 90er-Jahre ist das ein Top-Stall«, sagt Maria Prinz. Sie weiß noch, welche Kuh zuletzt wo gestanden ist. Mehrmals wiederholt sie, dass sie keines ihrer Kinder je zur Stallarbeit gezwungen habe. Obwohl für den Vater lange klar gewesen sei, »dass der Georg einmal den Hof übernimmt« und keine der beiden Töchter. »Die Matura machen zu dürfen, nicht zur Lehre gezwungen zu werden«, sagt Georg Prinz, »das war ein Befreiungsschlag und das Glück meiner Generation. In der Generation meines Vaters wäre ich gezwungen worden«.
Die Distanz zu seinen Eltern ist unübersehbar. Gleichzeitig merkt man allen Beteiligten ein zurückhaltendes Bemühen umeinander an, den zurückgehaltenen Wunsch, sich einander wieder anzunähern. Je länger er am Hof seiner Eltern ist, desto häufiger wechselt der Sohn völlig selbstverständlich zum »Wir«, wenn er vom Geschehen am Hof spricht.
Was viele seiner aktivistischen MitstreiterInnen nicht wissen: Es gab eine Zeit, als Bub, da hat Georg Prinz sogar selbst Kaninchen geschlachtet. Tiere, die er davor gestreichelt hatte. Und bis ins Gymnasium verteilte er voll Stolz Schulmilch. »Ich dachte wirklich, das wäre gut.« Eine schonende Form der Milchwirtschaft hielt er noch für akzeptabel, als er selbst bereits aufgehört hatte, Fleisch zu essen. Das war mit zwölf.
»Meinem Vater hat es das Herz gebrochen, als die letzten drei Kühe geholt wurden.«
– Veganaktivist Georg Prinz
Er weiß auch: Allein durch die Beobachtungen am Hof seiner Eltern wäre er nicht zum Kämpfer gegen die Nutztierhaltung geworden. Erst als an der Hauptschule ein Biologielehrer ein Video über Schweinehaltung zeigte, begann er, alles zu hinterfragen. »Man denkt ja, ein Bauernbub weiß, wie Tiere gehalten werden. Aber der Tod ist auf einem Milchhof weit weg. Man sieht die Tiere jeden Tag beim Melken und irgendwann werden sie weggebracht.« Die Bäuerinnen und Bauern selbst müssten das ausblenden. »Meinem Vater hat es das Herz gebrochen als die letzten drei Kühe geholt wurden.«
Kein Fleisch zu essen, das ließ sich nicht verheimlichen, wenn der Student aus Wien übers Wochenende nach Hause kam. Dass er sich aktiv gegen Nutztierhaltung und in der Stadt für Tierrechte einsetzte, dafür schämte er sich aber lange Zeit. »Ich hab zu Hause lang herumlaviert und es nicht ausgesprochen.« Als er vor ein paar Jahren schließlich beim Verein gegen Tierfabriken angestellt wurde, hätten sich die schockierten Eltern trotzdem gefreut, sagt er. »Sie waren froh, dass ich überhaupt eine Arbeit habe. Weil Engagement ohne Entgelt ist in der Welt meiner Eltern nicht vorgesehen.«
Grünland bringt Milch für 400 Personen
Der Stall mag leer sein. Eine Problemstellung bleibt: »Wir haben fast lauter Grünland. Selbst können wir das Gras aber nicht essen«, sagt Peter Prinz. Sogar falls er die dafür erforderliche Genehmigung bekäme, das Land zu pflügen: Seine mageren Wiesen lassen sich nicht einfach in fruchtbares Ackerland verwandeln. So wie der Betrieb von Maria und Peter Prinz bis vor Kurzem bewirtschaftet wurde, mit seinen 35 Rindern, 13 davon Milchkühe, rechnet Stefan Hörtenhuber, Nutztierwissenschafter an der Wiener Universität für Bodenkultur, vor, »konnte er den Milchbedarf für 400 Durchschnittspersonen zur Verfügung stellen und außerdem den vollen Fleischbedarf von knapp 30 Durchschnittspersonen abdecken«. Halbwegs effizient für die Lebensmittelproduktion lässt sich das Land der Familie Prinz nur mit Vieh bewirtschaften. Wenn vergleichbare Betriebe aufgeben, ist es deshalb üblich, dass deren Wiesen und Felder an einen verbliebenen Milchviehbetrieb verpachtet werden. Dieser kann damit seine Herde aufstocken und die Flächen bleiben der Lebensmittelproduktion erhalten.
Dauergrünland
Wiesen und Weiden (Grünland), die mehr als fünf Jahre nicht als Acker genutzt wurden, sind ökologisch besonders wertvoll, binden CO2, schützen vor Bodenerosion, lassen Niederschlagswasser auch bei Starkregen gut versickern und dürfen nicht ohne Genehmigung gepflügt werden.
Im Zuge der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP 2023–2027) erhalten LandwirtInnen Ökologisierungszahlungen (u. a.) für den Erhalt von Dauergrünland.
Georg Prinz weiß das, er ist Realo. Sachte hat er zu Hause schon einmal angesprochen, ob sich der Hof nicht vielleicht auch als »Gnadenhof« betreiben ließe, auf dem freigekaufte Tiere irgendwann eines natürliches Todes sterben dürfen. »Die bestehenden Gnadenhöfe sind sowieso hoffnungslos voll und auch behördliche Abnahmen verwahrloster Tiere gibt es immer wieder.« Er weiß auch, dass es am Selbstverständnis einer Bauernfamilie nagen würde, völlig aus der Lebensmittelproduktion auszusteigen und sich rein für Landschaftspflege und das Betreiben eines Streichelzoos bezahlen zu lassen.
Gnadenhof
Gnaden- oder Lebenshöfe kümmern sich um alte, kranke, gerettete oder notleidende Nutz- und Haustiere. Finanziert werden sie über Tierpatenschaften, Spenden, Fundraising und BesucherInnen.
Bekannt z. B. der von zwei Vereinen betriebene Bio-»Lebenshof RinderWahnSinn« aus Gföhl im Waldviertel.
rinderwahnsinn.at
Der ganzen Familie ist aber bewusst, dass es für den Prinzhof bald eine Lösung braucht. Mutter Maria ist mittlerweile in Frühpension. Vater Peter wartet gerade auf die Ergebnisse seiner medizinischen Untersuchungen. Er hofft, dass sie auch bei ihm eine Erwerbsunfähigkeitspension ergeben werden. Und dann? Herrscht Schweigen. »Es wird sich eine Lösung finden«, sagt Maria Prinz dann. Der Stall bleibt jedenfalls leer. »Leider«, sagt Frieda Prinz, 84, Altbäuerin und Großmutter von Georg. »Da werden heuer wahrscheinlich auch keine Schwalben mehr kommen«, bedauert sie. Einen Sommer ohne Schwalben, den gab es hier am Hof noch nie. Aber ein leerer Stall ohne Fliegen ist für die Zugvögel uninteressant. Gegen einen Gnadenhof hätten Schwalben aber vermutlich nichts einzuwenden. Und vielleicht findet sich ja auch mit dem Fuchs ein Auskommen. »Eigentlich«, sagt Maria Prinz nämlich, »eigentlich möchte ich wieder ein paar Hendln«.
»Stallschwalben«BIORAMA #78
Als Kulturfolger haben sich Rauchschwalben an das Leben in Ställen angepasst. »Sie profitieren von der Wärme und dem Insektenvorkommen altmodischer Stallarchitektur«, sagt Hans-Martin Berg, Insektenforscher am Naturhistorischen Museum Wien. »Stark durchlüftete moderne Ställe oder leerstehende Ställe sind für sie nicht interessant.«




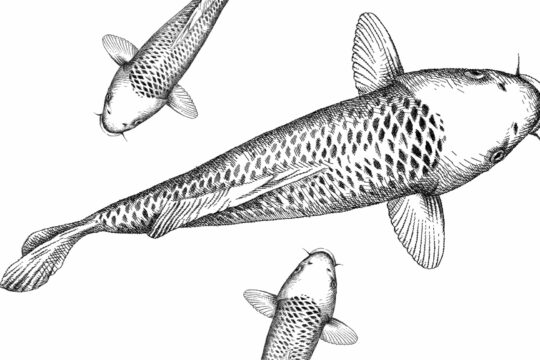




 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.