Lösungen – am Markt finanziert
Die Anzahl an Unternehmen, die gegründet werden, um ein gesellschaftliches Problem mit den Mitteln des Unternehmertums zu adressieren, wächst. Sie haben eigene Bedürfnisse.

Gutes tun – und damit Geld verdienen. Diese Formel erscheint nicht nur allzu einfach, sie ist es auch. Das bedeutet aber nicht, dass nicht rein auf Profit ausgerichtete Formen des Wirtschaftens nicht doch möglich sind. Die Idee, als UnternehmerIn gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist noch viel älter. Aber auch seit der Begriff des Social Entrepreneurship vor mehr als 20 Jahren aufgetaucht ist, hat sich viel verändert, in erster Linie professionalisiert. Gerade der Bereich des Social Entrepreneurship ist aber nach wie vor tendenziell wild wuchernd und mitunter angetrieben von einem geradezu jugendlichen Enthusiasmus, der davon lebt, sich eben nicht von starren Kategorien und Denkweisen eingrenzen zu lassen.
Im Mittelpunkt des Interesses von Unternehmen, die dem Social Entrepreneurship zugerechnet werden, steht die Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung, oft, aber nicht immer mit innovativen Konzepten. Die Kosten dafür werden aus Markteinkünften durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen gedeckt. Das unternehmerische Geschäftsmodell ist der Mittel zum Zweck, aber nicht der Zweck selbst. Social Entrepreneurship will eine Wirkung erzielen und den dafür nötigen Aufwand möglichst selbst decken. Lassen sich darüber hinaus Gewinne erzielen, werden diese oftmals größtenteils reinvestiert und nicht entnommen, um so die Wirkung weiter zu erhöhen. InvestorInnen und KapitalgeberInnen müssen damit leben, dass die finanzielle Rendite meist kleiner bleiben wird. Die Beispiele sind vielfältig und machen schnell deutlich, dass klare Grenzziehungen hier schwierig sind: Die Vollpension in Wien ermöglicht es PensionistInnen, in den Kaffeehäusern Kuchen zu backen, der verkauft wird. Recup und Rebowl wollen in ganz Deutschland recycelbare Mehrwegpfandsysteme anbieten. Im Grätzl lädt ein zum Kooperieren, Sharen und Tauschen und will neue Formen der Zusammenarbeit und Gemeinschaft unterstützen.
Startnachteil
Markus Sauerhammer, 1. Vorstand von SEND, dem 2016 gegründeten Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e. V., hat viele Jahre im deutschen Kammersystem gearbeitet. Heute setzt er sein dort gelerntes Wissen über Lobbyarbeit für das Thema Social Entrepreneurship ein. Für Sauerhammer ist einer der größten Unterschiede zwischen klassischen Unternehmen und denen der Social-EntrepreneurInnen, dass Erstere vielfach Kosten externalisieren und der Allgemeinheit übertragen. So, wie wir generell die Kosten für unsere Lebensweise – gerade was Umweltfragen angeht – in andere Länder, meist im globalen Süden, auslagern und in eine Zukunft, deren Teil wir nicht mehr sein werden. Soziale Unternehmen internalisieren diese zu einem überdurchschnittlich hohen Teil: »Dies führt auf dem Markt zu einer Verzerrung und zu einem Startnachteil für soziale Unternehmen«, sagt Sauerhammer.

Wird über SDGs und ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit (ESG) gesprochen, so lassen sich diese Bereiche trennen. Spricht man von Social Entrepreneurship, müssen und können diese nicht getrennt betrachtet werden, sondern es geht eben darum, diese zu verbinden. »›Social‹ kommt aus dem Englischen und meint hier allgemein ›im gesellschaftlichen Interesse‹«, erklärt Sauerhammer. Constanze Stockhammer, Geschäftsführerin von SENA, dem Social Entrepreneurship Network Austria, ergänzt: »Das deutsche ›sozial‹ lässt mitunter schnell an Fürsorge und Wohlfahrt denken, doch darum geht es nicht.«
»Laut einer EU-weiten Studie ist jedes vierte neu gegründete Start-up ein Social Business.«
Constanze Stockhammer, SENA
»Social Entrepreneurship ist nicht non-profit«, steht einleitend auf dem Social Entrepreneurship Monitor Österreich 2020, den SENA im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftsstandort und Digitalisierung erstellt hat. SENA wurde 2018 als Verein – durchaus nach dem Vorbild von SEND – gegründet. Es versteht sich als Interessensvertretung und Vernetzungsplattform, deren Mitglieder selbst Social-EntrepreneurInnen sind, und darüber hinaus gibt es ein PartnerInnennetzwerk und UnterstützerInnen. Für SENA-Geschäftsführerin Constanze Stockhammer gehört zu den Kernzielen des Verbands die Vernetzung und Unterstützung – auch mit StakeholderInnen und anderen Playern. Besonders wichtig sei es in Österreich auch, mit dem Thema außerhalb Wiens – hier gibt es mit dem globalen Social-Entrepreneurship-Netzwerk Ashoka oder auch dem Impact Hub schon länger Anlaufstellen – Service und Unterstützung in den Bundesländern zu bieten. Besonders erfreut ist sie, dass es gelungen ist, das Thema auch im Programm der aktuellen Regierung zu verankern.
Weiterbildung in Beratungsstellen
Stockhammer setzt dabei unter anderem auch auf eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer. Als Unternehmen sind Social-EntrepreneurInnen meist zwangsweise Mitglieder der Wirtschaftskammer, können von dieser aber nicht unterstützt werden, wenn sie mit ihren Anfragen und Ideen, etwa bei den regionalen Gründerservices, in erster Linie auf Unverständnis stoßen. Hier braucht es Aus- und Weiterbildung im Personal der Wirtschaftskammer: »Laut einer EU-weiten Studie ist jedes vierte neu gegründete Start-up ein Social Business«, weiß Stockhammer. Der Bedarf ist also da.

Dass gerade in Österreich rund ein Viertel der Social Business als Vereine organisiert sind, dafür gibt es gute Gründe: So ist der Verein zum Teil die erste Organisationsform, bevor später etwa eine GmbH gegründet wird. Diese hat Vorteile, wenn es etwa darum geht, MitarbeiterInnen auch im Sinne des eigenen Impacts ordentlich anzustellen oder regional Teil von Wertschöpfungsketten zu werden. Zum anderen liegt es aber auch an Regulierungen, die etwa vorsehen, dass bestimmte Leistungen von der öffentlichen Hand nur von Vereinen zugekauft werden dürfen und nicht von Unternehmen – zum Beispiel, wenn Bildungsdirektionen externe Vorträge in Auftrag geben wollen. »Aber auch das Stiftungsrecht ist, anders als in Deutschland, in Österreich sehr restriktiv und bedarf einer Reform«, so Stockhammer: »Hier liegt Geld brach, mit dem in Deutschland Social Business unterstützt werden.«
Regeln aus einer anderen Zeit
Strukturen, die überdacht werden können, gibt es viele. Markus Sauerhammer: »Man muss stolz auf die soziale Markwirtschaft sein, denn der Markt regelt eben nicht alles, sondern es braucht Eingriff und Transfer. Die Regelungen, die wir hier heute haben, kommen aber aus einer anderen Zeit und Struktur und die Frage ist, wie wir die aktuellen Herausforderungen anpacken können.«
»Wir sind in einer Umbruchphase, es geht darum, Menschen für die Gestaltung dieser zu begeistern und mitzunehmen.«
Markus Sauerhammer, SEND
Deswegen braucht es das Mitziehen der Politik, die die Regelungen festlegt. Dazu gehören für ihn auch Länder, die das Gemeinwohl in ihre Statistiken aufnehmen, und Kommunen, die einen Jahreswohlstandsbericht einführen. Er stellt sich dabei durchaus die Frage: »Wie sehr darf ich Stachel im Fleisch sein?« Denn es gibt sowohl klassische Unternehmen, die eine Transformation anstreben, wie auch solche, wo das nur schwer möglich ist, etwa wenn in ihrem Geschäftsmodell die Schädigung der Natur verankert ist. Markus Sauerhammer ist die Rolle im Verband zwar angetreten, um aktiv für eine Veränderung zu kämpfen und Lobbyismus zu betreiben, er sieht seine Aufgabe aber auch darin, Brücken zu bauen und etablierten Unternehmen einen Weg zur Transformation zu zeigen: »Wir sind in einer Umbruchphase, es geht darum, Menschen für die Gestaltung dieser zu begeistern und mitzunehmen. Es gibt auch in der klassischen Wirtschaft viele, die sich auf den Weg machen und eine Verbesserung anstreben.«
Social Entrepreneurship braucht aber auch die EndverbraucherInnen: »Ich bin selbst Teil des Problems und nicht der Lösung und habe im globalen Vergleich einen Riesenfußabdruck«, sagt Sauerhammer. Aktuell entscheiden Banken darüber, welche Unternehmen Kredite bekommen und finanziert werden. Über Modelle wie Crowdfunding können KonsumentInnen neue Projekte ermöglichen. In der Beobachtung von Sauerhammer tun sie das auch bereits über Konsumentscheidungen – noch nimmt die öffentliche Hand aber diese Entscheidungen zu wenig auf.
Eine alte Idee, aber jetzt digital und überregional
Dass Social Entrepreneurship sich schwer in klassischen Wirtschaftsregelungen und Sichtweisen abbilden lässt, macht die Idee naheliegend, für diesen Bereich eine eigene Rechtsform zu entwickeln. Eine, in der ShareholderInnen wenig bis keinen Einfluss haben und nur ihren Kapitaleinsatz verzinst bekommen. Genannt wird hier oft der ursprüngliche Genossenschaftsgedanke, der ins digitale Zeitalter transferiert werden muss. Die Digitalisierung kann helfen, die Modelle überregional aufzusetzen. Anders als klassische Start-ups skalieren Social Business nämlich nicht – nicht finanziell. Und deswegen greifen oft die bestehenden Förderungen nicht, die sich an Werten wie schnellem Wachstum und Profit orientieren. Im klassischen Bild erwirtschaften Unternehmen Gewinne, zahlen Steuern und finanzieren so die Allgemeinkosten. Social-EntrepreneurInnen adressieren selbst die Probleme, suchen Lösungen und versuchen diese zu skalieren.
Vorschläge für die Verbesserung der Situation von Social Business gibt es viele. Dazu gehören steuerliche Incentives für InvestorInnen, die Forcierung nachhaltiger öffentlicher Beschaffung oder auch die Erhöhung der betriebswirtschaftlichen Kompetenz unter den Social-EntrepreneurInnen. Zentral für Social-EntrepreneurInnen ist es, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und Identität zu schaffen – für Stockhammer nicht durch eine neue Rechtsform, sondern durch ein öffentliches Register, in das jene Unternehmen aufgenommen werden, die die zentralen Kriterien eines Social Enterprise erfüllen. Und diese zentralen Kriterien sind eben die unternehmerische Ausrichtung (dokumentiert etwa durch einen Gewerbeschein oder Umsatzsteuerpflicht) und inhaltlich die Fokussierung auf die Lösung eines gesellschaftlichen Problems, die über entsprechende Wirkungsberichte nachgewiesen wird. Hier gebe es bereits durchaus brauchbare Social-Reporting-Standards. Darüber hinaus kann in den Statuten oder Gesellschaftsverträgen eine nachprüfbare Selbstverpflichtung verankert werden – die die Gewinnorientierung nachreiht. »Social-EntrepreneurInnen sind gekommen, um zu bleiben«, ist Constanze Stockhammer überzeugt: »Das Thema ist kein Hype, sondern die notwendige Antwort auf viele Herausforderungen unserer Gesellschaft.«



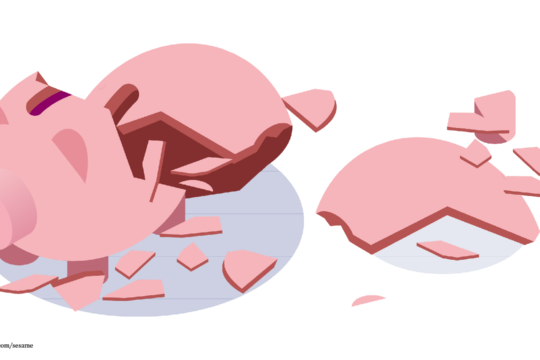





 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.