Stefan Soder über seinen ‚Jahrhundert-Roman‘

„Simonhof“ von Stefan Soder (erschienen im Braumüller Verlag)
„Simonhof“, der zweite Roman des gebürtigen Brixentalers Stefan Soder, erzählt über mehrere Generationen hinweg die Geschichte eines Tiroler Bauernhofs. Im Interview spricht der Wahlwiener über seine Recherche-Methoden im bäuerlichen Milieu, Alpintourismus – und den Luxus, ein eher unbekannter Autor (mit Brotjob) zu sein.
BIORAMA: In „Simonhof“ erzählst du die Geschichte eines Tiroler Bergbauernhofs über mehrere Generationen vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis hinein ins 21. Jahrhundert. Du bist selbst im Brixental aufgewachsen, lebst aber seit vielen Jahren fernab von Landwirtschaft und Tourismus als Berater in Wien. Warum wolltest oder musstest du diese Geschichte erzählen?
Stefan Soder: Ich beginne erst allmählich, das Warum zu verstehen. Obwohl beide Bücher im Konkreten nichts mit meiner eigenen Geschichte zu tun haben, ist mein erster Roman „Club“ das Buch meiner Ängste, „Simonhof“ das Buch meiner Herkunft. Vielleicht denke ich in ein paar Jahren anders darüber, aber momentan erscheint es mir so.
Gibt es ein reales Vorbild – also auch ein physisches Gebäude oder eine dir bekannte Familiengeschichte – für den „Simonhof“?
Stefan Soder: Was die Geographie und das Gebäude anbelangt, nein. Die Geschichte spielt irgendwo in den Zentralalpen, die Alm ist eine Kombination aus mehreren mir bekannten Orten, aber doch ganz eigen. Details des Hofes kenne ich von Bauernhöfen oder Almen, aber auch hier gibt es kein konkretes reales Vorbild. Auch was das Narrative betrifft habe ich nichts aus meiner Familiengeschichte ‚verwurstet‘ – höchstens kleine Details übernommen. So wurde beispielsweise ein Verwandter vom Äffchen eines Besatzungssoldaten gebissen, was ich verwendet habe.
Dein Roman beginnt mit dem ersten Simonbauern, dem als Zweitgeborenen eines Kleinbauern eigentlich ein Schicksal als Knecht auf einem anderen Hof bestimmt wäre, der aber beim Kartenspielen eine Almhütte gewinnt, die er und seine Nachfahren mit Fleiß, aber auch sehr viel Glück über mehrere Generationen zum prächtigen Simonhof ausbauen. Am Ende des Romans pokert sein Ur-Ur-Enkel gewissermaßen mit den Banken und setzt mit einem waghalsigen Tourismusprojekt alles auf eine Karte. Fast alles scheint wieder verloren, was aber bleibt ist – immerhin – der Hof. Brauchte es im Tirol an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Glück im Spiel, um der gottgegebenen hierarchischen Gesellschaftsordnung im Dorf entkommen zu können?
Stefan Soder: Natürlich gab es auch andere Möglichkeiten. Beispielsweise konnte man ein Handwerk erlernen, in der Stadt sein Glück versuchen oder in der Fremde. Einige wenige durften in der Stadt in die Schule gehen und konnten Lehrer werden, Pfarrer oder Beamte. Man brauchte nicht unbedingt Glück im Spiel. Aber eine ordentliche Portion Glück, die brauchte es schon, wenn man sein Schicksal steuern wollte. Und natürlich hatten manche bessere Chancen, andere so gut wie keine. Mein Simon hat sein Glück beim Kartenspiel gefunden, obwohl (oder weil) er kein richtiger Spieler war.
Die alten Bilder, auf denen die Menschen sich ihr Festtagsgewand anzogen, um ernst und stillsitzend vor der Kamera eines Fotografen zu posieren, sagen wenig aus über den Alltag der Menschen.“ (Stefan Soder)
Wie hast du recherchiert? Wir bewegen uns in „Simonhof“ immerhin in einem Milieu, in dem Aufzeichnungen und Schrift traditionell eher keine Rolle spielen.
Stefan Soder: Die Recherche war für jede der vier Generationen unterschiedlich. Vor allem für die ersten beiden Teile habe ich mich über historische Aufzeichnungen in Bibliotheken informiert, aber auch über mündliche Erzählungen. Dadurch versuchte ich mir ein Gefühl dafür zu erarbeiten, was sein konnte, woraus die Rahmenbedingungen des Lebens bestanden. Je näher sich die Geschichten der Gegenwart nähern, umso mehr konnte ich mich auf direkte Erzählungen von Verwandten und Freunden stützen. Die Geschichten habe ich nicht übernommen, aber sie haben mein Erzählen erleichtert, weil die Lebenswelt lebendiger, greifbarer wurde. Ähnliches gilt für Bildmaterialien. Die alten Bilder, auf denen die Menschen sich ihr Festtagsgewand anzogen, um ernst und stillsitzend vor der Kamera eines Fotografen zu posieren, sagen wenig aus über den Alltag der Menschen. Aus den Siebzigern gibt es schon eine Menge an Material, von der heutigen Zeit ganz zu schweigen, wo die Bilderflut einem den Blick vielleicht schon wieder verbaut. Jedenfalls ist der Zugang zum Erzählen auch Thema des Buches.
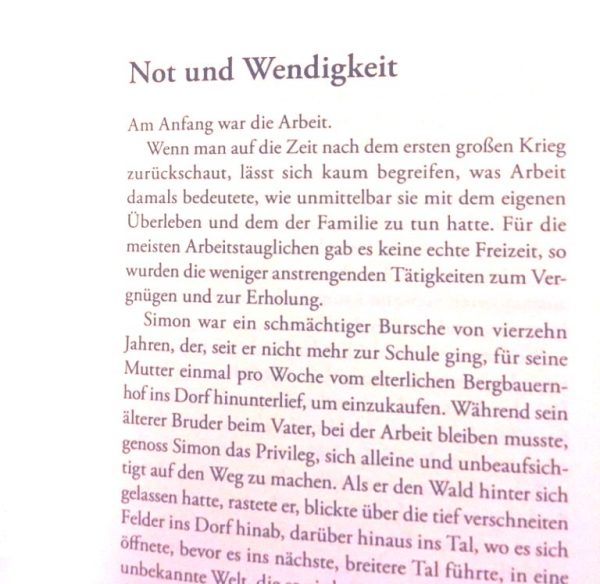
Von den Jahren des Nationalsozialismus zeichnet der „Simonhof“ ein besonders differenziertes Bild. Einerseits profitiert die Bauernfamilie von kriegsgefangenen Zwangsarbeitern aus dem Osten, die andererseits aber die Arbeitskraft des in den Krieg gezwungenen Vater kompensieren. Gleichzeitig verstecken und versorgen einige am Hof einen gelehrten Deserteur. War es schwierig, an Information über die NS-Zeit zu gelangen oder waren die von dir Befragten auskunftsfreudig?
Stefan Soder: Es war schwierig, schon alleine, weil viele Zeitzeugen damals sehr jung waren. Was ich erfahren konnte, waren gewisse Mechanismen, Machtstrukturen – also wieder Rahmenbedingungen. Und die Tatsache, dass man nach dem Ende des Krieges diesen vergessen wollte, dass dieser beispielsweise in der Schule einfach kein Thema war und ausgespart wurde – bestimmt nicht überall, aber bestimmt nicht nur in einem Dorf. Ich wollte ja keine Einzelschicksale nacherzählen, sondern eine eigene Geschichte entwickeln aus den Möglichkeiten. Die Informationen dafür erhielt ich zum Teil wiederum verpackt in Erzählungen von Einzelschicksalen.
Zugespitzt könnte man sagen, auf dem Simonhof bestimmen die Männer, was geschieht. Die Frauen bestimmen, was geschehen ist.“ (Stefan Soder)
Die Entwicklung vom traditionellen Bauern zum agrarindustriellen Zeitalter oder später zum Alpintourismus schilderst du weniger als Generationenkonflikt, sondern eher als eine Art Generationensprung. Den Alten fehlt das Verständnis für die An- und Absichten der Jungen – zumindest bei den männlichen Familienmitgliedern. Frauen sind bei dir stets die Vermittler, die Konstante. Warum?
Stefan Soder: Es ist ja auch schwer zu fassen, in welch kurzer Zeit sich das Leben auf einem solchen Hof so einschneidend ändern konnte. Das sind tatsächliche Sprünge, mit denen manche alte Generation in meiner Geschichte ihre Schwierigkeiten hat. Es ist nun einmal so, dass es der Bauer ist, der letztendlich entscheidet. Daher kommt den Frauen eine andere Rolle zu. Wie einleitend erklärt wird, ist es eine Geschichte über die Bauern und deren Taten. Dafür nehmen die Frauen die entscheidende Rolle ein, was das Erzählen betrifft. Erzähler sind immer auch Vermittler. Zugespitzt könnte man sagen, auf dem Simonhof bestimmen die Männer, was geschieht. Die Frauen bestimmen, was geschehen ist.
„Simonhof“ wird aus der Perspektive einer jungen Frau erzählt. Genaueres über die Erzählerin erfährt man aber erst auf den allerletzten Seiten. Über weite Strecken mischt sie sich nur über vereinzelte, kurze wertende Passagen ein. Ihr Einleitungskapitel allerdings liest sich fast als persönliche poetologische Programmatik – die Frauen erzählen, gewichten und deuten, die Männer hören zu und greifen höchstens korrigierend ein. War für dich von Anfang an klar, dass du die Geschichte aus weiblicher Sicht schildern wirst?
Stefan Soder: Nein, die Geschichte war in ihren Grundzügen schon ausgearbeitet, aber ich habe immer noch mit dem Finden einer für mich stimmigen Perspektive gerungen, was sich in meinem Schreiben offenbar immer wieder als aufwändiger Schritt erweist. So banal es klingen mag – Erzählen braucht eine funktionierende Mischung aus Distanz und Nähe.
Irgendwann war klar, dass es eine außenstehende Person braucht, die aber auch in die Familiengeschichte eingeweiht ist. So bin ich allmählich auf die Tochter gekommen, die erst in ihrer Kindheit von der Stadt an den Hof kommt. Der alles vertraut ist, die Geschichten, das Leben da oben, die aber auch stets eine Außenseiterin bleiben wird, was ihr das Erzählen erst ermöglicht.

Der gebürtige Tiroler Stefan Soder ist im Brotberuf Betriebswirtschafter. Sein Schreiben finanziert er sich durch freiberufliche Beratungsjobs. (Foto: Jellybean)
Nach dem Stammvater heißen alle Söhne und Enkel immerfort Simon. Ich muss gestehen, dass ich mir beim Lesen einen Stammbaum gewünscht hätte, in dem ich immer wieder nachsehen kann, von welchem „Simon“ gerade die Rede ist. Die weiblichen Figuren hingegen haben alle unterschiedliche Namen und Charakter. War es Absicht, dass die namensgebenden männlichen Hauptpersonen am „Simonhof“ im Laufe der Lektüre ineinander verschwimmen?
Stefan Soder: Ich habe mit dieser Namensgebung die prinzipielle Ähnlichkeit der Bauern betonen wollen, alle aus einem Holz geschnitzt – die erst anhand der verschiedenartigen Umstände zu unterschiedlichen Charakteren werden. Zudem ist die Namensgleichheit in der Praxis nicht unüblich. Den Wunsch nach einem Stammbaum kann ich verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Bedürfnis an der Namensgleichheit der Bauern liegt. Wenn ich das Buch als Große Familiensaga angelegt hätte, ausgeschmückt mit Nebenfiguren und Handlungssträngen, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber ich wollte diese einfache, schlanke, fast karge Form finden – und da hoffe ich, dass die Orientierung noch machbar ist. Der Stammbaum existiert exklusiv auf meiner Festplatte.
Das bäuerliche Milieu ist in der österreichischen Nachkriegsliteratur alles andere als selten. Nach einer Reihe von Anti-Heimatromanen in den 70er und 80er Jahren dominierte in den 90er Jahren und nach 2000 allerdings tendenziell das Urbane. 2016 ist Reinhard Kaiser-Mühleckers „Fremde Seele, dunkler Wald“ erschienen, ebenfalls in der bäuerlichen Welt angesiedelt, nun dein „Simonhof“. Purer Zufall?
Stefan Soder: Ich habe mit „Club“ 2009 angefangen – in dem es übrigens nicht um Clubcultur geht. Mit „Simonhof“ habe ich 2013 begonnen. Leider brauche ich so lange, sonst könnte ich das etwas besser steuern. Als ich das Manuskript für „Simonhof“ fertig hatte, habe ich mich an den Verlag gewandt, das war im Frühjahr 2016. Sie haben mich auf ein anderes Buch aufmerksam gemacht, „Ein ganzes Leben“ von Robert Seethaler. Das habe ich mit Vergnügen gelesen, aber ich fand es nicht störend, dass es auch im ländlichen Milieu spielt. „Fremde Seele, dunkler Wald“ habe ich noch nicht gelesen. Ich schreibe entlang meiner eigenen Interessen. Wenn ich einen Stoff finde, mit dem ich mich über Jahre beschäftigen kann und will, so ist es wie ein Geschenk für mich. Wenn ich dann fertig bin, habe ich wirklich keine Ahnung, wo ich damit im Büchermarkt stehe. Der Verlag sieht das naturgemäß anders.
Für mich selbst waren beide Bücher riskant. Im ersten geht es um einen Sterbeclub, um Abhängigkeiten, Sex, Eskapismus und Todessehnsucht. Und jetzt diese so einfach daherkommende Bauerngeschichte.
Das ist der Vorteil, ein nicht so bekannter Autor zu sein. Es gibt kaum Erwartungen von außen, die einen beeinflussen oder treiben. Man kann den inneren Bedürfnissen und Interessen folgen.
Jede Generation des „Simonhof“ steht vor der Frage: Was tun mit dem Hof? Wie lässt er sich weiterentwickeln? Du bist studierter Betriebswirt, hast eine Karriere als Berater hinter dir und finanzierst dir deine literarische Tätigkeit indem du gelegentlich freiberufliche Beratungsaufträge annimmst. Würdest du heute den „Simonhof“ erben – was würdest du damit tun? Oder was würdest du – als Berater – den Erben raten?
Stefan Soder: Dankenswerterweise habe ich noch nie einem Unternehmen raten müssen, wie es mit dem Betrieb weitergehen soll. Ich berate in einem recht engen, technischen Fachgebiet, in dem ich mich einigermaßen auskenne. Zu raten hätte ich den Erben also gar nichts, ich würde sie einfach beglückwünschen. Wenn mir selbst ein kleiner Hof in die Hände fiele, wäre das eine schwierigere Angelegenheit. Da müsste ich mich vielleicht tatsächlich neu erfinden. Die Verlockung wäre sehr groß.
„Simonhof“ von Stefan Soder ist im Jänner 2017 im Wiener Braumüller Verlag erschienen.








 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.