»Es gibt das unsinnige Gärtnern«
Ein Staudengartenexperte spricht Klartext.

Warum man sich wilde Pflanzen ausgerechnet in den Garten holen möchte – und welche. Ein Gespräch mit dem auf Stauden spezialisierten Gärtner (und ehemaligen Drogisten) Dieter Gaißmayer.
BIORAMA: Sie bieten auf der Website der Gärtnerei »heimische Wildstauden an« – Heißt das, dass diese in der Natur auch so zu finden sind?
Dieter Gaißmayer: Der Begriff Wildstauden bedeutet nur, dass diese Stauden züchterisch nicht bearbeitet sind und so in der Natur vorkommen. Heimische Wildstauden ist ja eine Einengung. Das sind dann Stauden, die in unserer Region heimisch sind.
Wie viel Platz gibt es insgesamt?
Das wird ein kompakter Beitrag, wir haben zwei Seiten Platz.
Aber das muss man erklären! Also: Der Begriff Staude heißt, es handelt sich um winterharte, krautige, mehrjährige Pflanzen. Es gibt eine Riesenauswahl an Stauden, die züchterisch bearbeitet sind.
Wildstauden sind Wildvorkommen. Heimisch ist immer relativ zu beurteilen: Im pannonischen Gebiet in Österreich sind das andere als in Schleswig-Holstein. Das ist ja logisch.
Was umfasst dieser Regionalitätsbegriff? In Ihrem Sortiment bedeutet »heimisch« dann also einen Kompromiss?
Genau. Wir führen in erster Linie welche, die in Mitteleuropa heimisch sind. Es gibt zusätzlich ein paar Besondere, nicht heimische – die Kundinnen und Kunden entscheiden, ob sie so etwas wollen. Schon die HunnInnen, die RömerInnen und die OsmanInnen haben Pflanzen mitgebracht und ein Teil dieser ist heimisch geworden in unserer Flora. Aber jetzt verschiebt sich das Ganze sowieso: Durch den Klimawandel kommen immer mehr Pflanzen aus dem Süden, denen geht es hier gut und darüber können wir froh sein. Der Begriff heimisch ist in Zeiten des Klimawandels nicht mehr das Evangelium, sondern wir brauchen Pflanzen, die hier natürlich wachsen.
»Der Begriff heimisch ist in Zeiten des Klimawandels nicht mehr das Evangelium.«
Dieter Gaißmayer, Staudengärtner
Und warum sollen wir heimische, natürliche Wildpflanzen im Garten gezielt anpflanzen?
Weil es einen noch nie dagewesenen Schwund an Insekten und anderen Kleinlebewesen gibt. Zumindest bei uns in der Bundesrepublik ist die Fläche der Hausgärten in Summe etwa so groß wie die aller Naturschutzgebiete. Deshalb zählt inzwischen jeder Quadratmeter, auch auf Balkon oder Terrasse. Mir ist wichtig, dass es nicht nur um Bienen geht: Vor ein paar Jahren hat man bloß über Honigbienen gesprochen, dann kamen Schmetterlinge und Wildbienen dazu. Aber es geht viel weiter: Ein Garten bietet Nahrungspflanzen und Unterschlupf für Vögel, für Heuschrecken – die sind auch bedroht, Ameisen sind bedroht! Wir wollen doch allen Lebewesen in unseren Gärten ein Refugium bieten – mit Ausnahme von Wölfen vielleicht – also zumindest den kleinen Lebewesen. Sodass Menschen und Tiere sich in unserem Garten wohlfühlen.
Die biozertifizierte Staudengärtnerei Gaißmayer bietet vor Ort in Illertissen (Bayern) und im Versand Stauden an, gibt zudem ungewöhnlich umfassende Spezialkataloge zum eigenen Sortiment heraus, die Pflanzenkunde rund um die erhältlichen Produkte enthalten.
Heißt heimisch auch pflegeleichter?
Es ist eine Illusion zu meinen, dass ein Garten mit heimischen Pflanzen pflegeleichter ist. Das müssen wir anders aufziehen: Zuerst einmal muss ich den Garten, die Fläche, die ich bepflanzen will, definieren: Ist das eine sonnige Fläche mit nährstoffreichem Boden oder nährstoffarm, kiesig und sandig? Dann muss ich die Pflanzen aussuchen, die dafür geeignet sind. Es gibt ja Schattenstauden, Sonnenstauden, es gibt Magerstauden, es gibt Sumpfstauden. Daher ist die Standortgerechtigkeit der erste Teil des Geheimnisses eines grünen Daumens.
Der Mensch muss im Garten immer regulierend eingreifen. Das heißt, er muss sich Arbeit machen, das ist der zweite Teil des Geheimnisses. Es gibt das intelligente Gärtnern: mit der Natur zu arbeiten. Und es gibt das unsinnige Gärtnern: sich viel Arbeit zu machen, weil man sich nicht kundig gemacht hat – zum Beispiel keine standortgerechten Pflanzen verwendet. Relevant ist drittens auch noch das Wuchsverhalten. Es gibt Pflanzen, die wuchern wie der Teufel, oder sie versamen ganz schrecklich, und dann werden die dominant – das wollen wir nicht. Also: So einfach ist es nicht.
Zitieren Sie mich nicht in diesem Sinne, dass ich gesagt hätte, »man muss eigentlich im Naturgarten nichts tun«! Ein solcher Naturgarten ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Was ist dann eine gute Balance zwischen Gestaltung im Garten und Inruhelassen – um ein »wildes« Refugium für tierische und pflanzliche Vielfalt zu bieten?
Wenn ich standortgerechte Pflanzen verwende, wird das einfacher. Bei uns Staudenleuten gibt es dafür Kennziffern, Kürzel für die Lebensbereiche, die auf jedem Etikett, in jedem Katalog und im Internet angegeben sind. Aus diesen Möglichkeiten kann man sich die passenden aussuchen. Das Gleiche gilt für das Wuchsverhalten: Es wird von 1 bis 6 klassifiziert.
Wenn jemand sagt »Ich bin einfach faul«, dann eignen sich Pflanzen, die wuchern und vielleicht auch welche, die stark versamen. Aber es braucht trotzdem Eingriff und Regulierung, sonst wuchern die wenigen, die dies am besten können, den ganzen Garten zu – und die anderen werden verschwinden.
Wollen wir noch drei unkomplizierte heimische Wildstauden herauspicken und besprechen, was sie zum vielfältigen Garten beitragen – idealerweise solche, die auch als Arzneipflanze zum Einsatz kommen?
Ja. Können Sie mir die gleich benennen?
Johanniskraut, Malve und Knabenkraut?
Das Knabenkraut können Sie vergessen. Das ist eine Orchidee: viel zu heikel. Da müssten Sie sich eine andere Staude aussuchen.
Okay, nehmen wir den Frauenmantel?
Den Blutstorchenschnabel! Oder was halten Sie vom Eibisch? Wie wär’s mit dem Baldrian? (Dieter Gaißmayer schlägt vor, das Telefoninterview zu unterbrechen, um seinen Heilpflanzenkatalog zu holen und damit weitere Ideen einzubringen. Im zweiten Teil des Gesprächs erfolgt eine Einigung auf vier Pflanzen, Anm.) Also die Folgenden sind Allerweltspflanzen, die man besser anpflanzt als aussät.
Und Sie haben drauf geachtet, Pflanzen auszuwählen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten blühen, damit die Insekten stets versorgt sind.
Ja. Das Johanniskraut blüht im Spätfrühling, es mag keinen zu fetten Boden und will nicht gedüngt werden. Die Blätter und Blüten sind gut für einen Ölansatz geeignet, dazu sollte man sich aber noch ein bisschen einlesen.
Im Frühsommer blüht die Wilde Malve, hier ernten man die Blüten und trocknet sie – ein Aufguss dieser wird als Tee zum Beispiel zur Verdauungsförderung getrunken.
Oregano blüht dann ab dem Spätsommer, über den freuen sich besonders die Schmetterlinge. Er möchte übrigens keine nährstoffreichen Böden. Man erntet sein Laub, es wirkt ebenfalls verdauungsfördernd.
Im frühen Herbst blüht die Solidago virgaurea, die Heimische oder Gewöhnliche Goldrute – nicht zu verwechseln mit der Kanadischen Goldrute. Erstere hat eine schleimlösende Wirkung. Besonders wegen der späten Blütezeit bildet sie ein Insektenparadies.
Damit leiste ich schon einen sinnvollen Beitrag zu einem gelungenen Insektenjahr?
Zwischen den Stauden sollten Sie Blumenzwiebel setzen, damit früh im Frühjahr schon etwas blüht, zum Beispiel Wildkrokusse!

Dieter Gaißmayer
hat die von ihm ab 1980 aufgebaute Staudengärtnerei inzwischen übergeben. Er widmet sich nun ganz der von ihm gegründeten, von der Gärtnerei mitfinanzierten, Stiftung Gartenkultur.

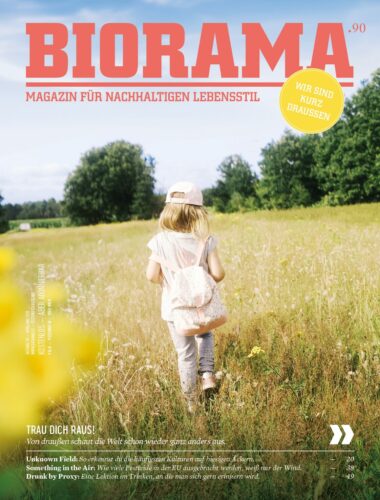



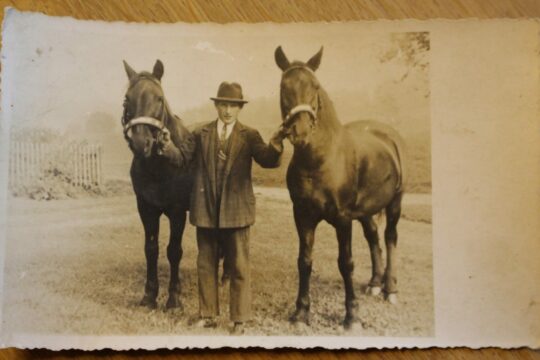


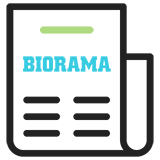
 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.